Am heutigen Standort in der Haydngasse befand sich seit 1386, als die
Kanizsai das Mauerrecht für Eisenstadt erhielten, ein von
Erzbischof Johann Kanizsai, Bischof von Erlau, sowie später
Erzbischof von Gran und ungarischer Reichskanzler, gegründetes
Kloster mit der Kirche zum hl. Evangelisten Johannes. Das Kloster
gehörte zur ungarischen, später Marianische oder Marianer genannten
Provinz der Franziskaner, für die im Mittelalter die Bezeichnung
„Fratres Minores“ (Minderbrüder, Minoriten) gebräuchlich war.
In
einer Ablassurkunde von Papst Johannes XXIII. vom 26.2.1415 wurde das
Kloster erstmals genannt.
Fotokopie aus dem päpstlichen Register
Quelle: Bgld.
Heimatblätter
Ihr Titel
Conceditur Indulgentia visitantibus
Ecclesiam Minorum Castri
Kusmartonalis.
Universis et singulis Christifidelibus
praesentes l
itteras inspecturis, salutem etc.
deutet
klar an, daß es sich um ein Dokument handelt, in welchem für die
Besucher der Kirche der Minderbrüder in Eisenstadt ein Ablaß
erlassen wird, sodaß fest steht, dass Kloster und Kirche schon viele
Jahre vorher entstanden sind.
Das
mittelalterliche Kloster befand sich an der Stelle des heutigen
Franziskanerklosters im nordöstlichen Teil des spätmittelalterlichen
Siedlungsgebietes, unmittelbar an der Stadtmauer gelegen, und damit
an einem für Bettelordensniederlassungen charakteristischen Platz
mit der Funktion der Verstärkung der Stadtbefestigung.
Das
Kloster wurde in der Folgezeit von der Familie Kanizsai mit
Schenkungen bedacht, wodurch die materielle Basis für die Erfüllung
der Klosteraufgaben gesichert war. Darunter waren Besitzungen in
Kleinhöflein, St. Georgen und Oslip, sowie Einkünfte aus
Liegenschaften in Roy, Antau und Wulkaprodersdorf.
1529 wurde das Kloster im Zuge der Ersten Wiener Türkenbelagerung
zerstört, nach anderen Quellen von den Franziskanern durch Flucht
vor den Türken aufgegeben.
Neuer
Pfandherr wurde der evangelische Moritz von Fürst, danach Johann von
Weißpriach (Graf von Forchtenstein, Pfandinhaber der Herrschaften
Eisenstadt und Güns).
Der
Platz blieb verödet, es wurde 1569 als „öd Closter daselbst zw
der Eysenstadt“ bezeichnet.
Graf
Nikolaus Esterházy stiftete nach der siegreichen Schlacht von
Lackenbach 1625 ein Franziskanerkloster und ließ es unter Verwendung
der noch vorhandenen Bauteile in barockem Stil wieder aufbauen, und
er übergab es 1630 dem bereits 1625 gegründeten
Franziskanerkonvent, dem damals drei Priester und zwei Laienbrüder
angehörten.
Haupteingang zum Kloster
Foto: Hans Larnhof, 26.2.2020
Stiftungsurkunde des Franziskanerklosters aus 1768
über dem
Eingang zum Diözesanmuseum
Fotosammlung Margarete Kohs
Zugang zum Klosterbereich
Foto: Hans Larnhof, 26.2.2020
Kirche und Kloster brannten 1768 gemeinsam mit 141 Bürgerhausern,
u.a. auch des Augustinerinnenklosters und auch des Haydnhauses ab.
Bis zum Jahre 1772 wurde es mit Unterstützung durch Fürst Nikolaus
I. Esterházy nicht nur vollständig wiederhergestellt, sondern wurde
auch das Kloster durch den Aufbau eines zweiten Stockwerks
vergrößert.
1776
erlitt das Kloster wieder Brandschäden, die wieder auf Kosten des
Fürsten behoben wurden.
Während der NS-Herrschaft waren im Kloster u.a. das Burgenländische
Landesarchiv und das Archiv der Freistadt Eisenstadt untergebracht.
Zu Kriegsende fanden viele Eisenstädter im Kloster Zuflucht. Erst
1958 stand das Kloster wieder ganz allein den Franziskanern zur
Verfügung.
Foto: Margarete Kohs, Sommer 1953
Von 1958 bis 1959 erfolgte eine Innenrestaurierung, dabei wurden die
Malereien Stornos entfernt.
1971 erfolgte eine neuerliche Außenrenovierung.
1975 wurde das Kloster (ohne Kirche und Gruft) von der Diözese
Eisenstadt erworben und in den folgenden Jahren renoviert und
revitalisiert.
1980 wurde im zweiten Stock des Klosters das Diözesanmuseum
eingerichtet und in den darauf folgenden Jahren die Schausammlung
ständig erweitert. In jährlich wechselnden Sonderausstellungen
werden Themen beleuchtet wie zB burgenländische Kirchengeschichte
oder kirchliche Kulturgeschichte (wie Wallfahrten, Heiligenverehrung,
Kirchenmusik, Glasfenster oder Volksfrömmigkeit).
Foto: Margarete Kohs, 14.8.2005
Ostseite des Klosters mit einstigem Gemüse- und Blumengarten
Foto:
Margarete Kohs, 6.7.2005
Aus dem "Hauskloster" der Kanizsai stammt auch die älteste
deutsche Handschrift des Burgenlandes. Sie kam aus dem Bodenseeraum
und wurde wahrscheinlich von Johannes von Kanizsai, Erzbischof und
Kanzler Sigismunds, der am Konstanzer Konzil teilnahm, dem Kloster
geschenkt. Es ist dies ein "Märterbuch", eine
mittelhochdeutsche Heiligenlegendendichtung. Ein Teil dieser
Handschrift ist erhalten geblieben, weil sie später, im 17.
Jahrhundert, als Füllmaterial für die Buchdeckel von Waisenbüchern
des esterházyschen Familienarchivs verwendet wurde.
Eingang zur ehemaligen Bibliothek des Klosters
Foto: Hans Larnhof, 26.2.2020
Die 1963 durchgeführte Ablösung aller Esterházyschen Patronate
seitens des Fürsten beendete auch die Rechtswirksamkeit der
Stiftungsurkunde von 1631.
Blick in den Innenhof des Klosters
Foto: Hans Larnhof,
26.2.2020
Am 31. Oktober 2018 verließ der letzte verbliebene Franziskaner,
Pater Michael Schlatzer, das Kloster.
Quelle: Pannonien.tivi
Das Kloster wird nun vom Kalasantinerorden betreut.

















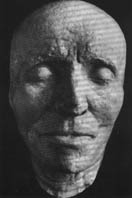

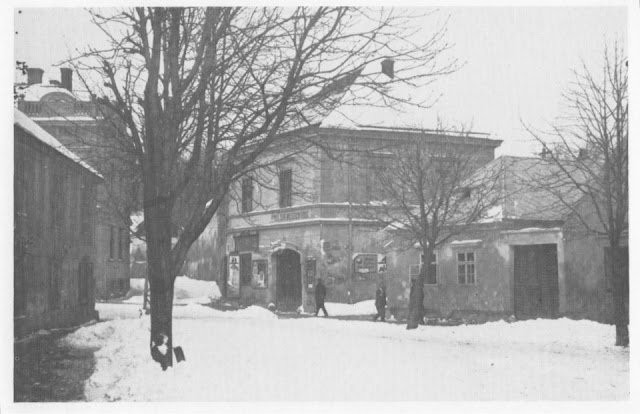
Kommentare
Kommentar veröffentlichen