Der Maler Michael Mayr und das „Haenlein-Haus“
Michael Mayr, geb. 6.7.1796 in Wien, erlernte zunächst das
Faßbinderhandwerk und war nach Ablegung der Präparandieprüfung
zwei Jahre als Lehrer tätig. Er fristete als Statist an den Wiener
Vorstadttheatern ein kümmerliches Dasein, wurde dann Sänger am
Theater an der Wien, wo er die Bekanntschaft der Dekorationsmaler de
Pian und Gail machte, welche sein Interesse für die Malerei weckten.
1822 arbeitete er im Atelier des k. Hoftheaters und ging 1830 mit dem
Dekorationsmaler Gail nach Olmütz, um das neuerbaute Theater
einzurichten. 1831 kam er ans Leopoldstädter Theater.
Um
sein schwer verdientes Geld kaufte er sich Stiche oder erwarb
Zeichnungen verstorbener Theatermaler. Im Fach immer vollkommener,
bekam er auch immer günstigere Engagements. Eine große Schar von
Wiener Malern gesellte sich zu ihm, die von ihm ständig Geld
borgten und ihre Schulden mit Gemälden abzustatten versuchten.
Er
war mit Lanner, Johann Strauß Vater und Raimund befreundet, malte
die Dekorationen zu den beliebtesten Stücken jener Zeit, so auch zu
Raimunds „Verschwender“, dekorierte Garten und Saalfeste von
Strauß und Lanner. Nach dem Brand des Wr. Neustädter Theaters
richtete er dieses 1836 neu ein und entwarf die neue Einrichtung. Als
Carl Bernbrunn, Theaterdirektor und Schauspieler (1787 - 1854) das
Leopoldstädter Theater übernahm, und Mayr 1846 eine unerwartete
Erbschaft machte, übersiedelte er nach Eisenstadt, wohin er auch
seine graphischen Sammlungen und die kleine Galerie dieser oft
namenlosen Kleinmeister mitnahm, deren Werke man in den Galerien
vergebens sucht, die aber in Auktionen doch nicht selten Vorkommen.
Die
graphische Sammlung bestand aus mehreren tausend Stichen und Skizzen
von Theaterdekorationen der Wiener Arrigoni, Gail, Bittner usw. Die
übrigen Blätter aber waren selten in gutem Zustand, die meisten
aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.
Aus
seiner Erbschaft besaß Mayr viele Möbel aus dem 18. Jahrhundert
und aus der Rokokozeit, außerdem Alt-Wiener Silber, Porzellan,
Textilien und Familienporträts aus den genannten Jahrhunderten.
Seine Wohnung erinnerte an ein kleines Museum, denn er besaß auch
ältere Gemälde.
Mayr
setzte seine Sammeltätigkeit auch in Eisenstadt fort und schon bald
scharte sich ein Kreis von jungen Künstlern um ihn, die er
unterstützte und förderte.
Von Mayr gibt es einige Bilder mit Eisenstädter Motiven:
Michael Mayr, Bergkirche, 1826
Quelle: Wikipedia
zur Verfügung gestellt von Klaus-Jürgen Bauer am 21.8.2014
Michael Mayr, Innenansicht des alten Stadttores in Eisenstadt
Quelle: Gerald Schlag: Biedermeier-Revolution-Neoabsolutismus.
Die Tagebücher Michael Mayrs 1822 - 1869, Eisenstadt 2006.
Michael Mayr, St. Georgen, 1825
Quelle: Wikipedia
Mayr hatte zwei Töchter. Die eine heiratete nach Wiener Neustadt
und bekam als Mitgift Bilder und Kunstobjekte. Die andere Tochter,
Marianne, blieb lange beim Vater und heiratete endlich Josef Fajt.
Nach
Mavrs Tod am 14.10.1870 übersiedelte Familie Fajt in die
Hauptstraße, gegenüber dem Rathaus, wo in drei Gassenzimmern die
nunmehr vereinigte Mayr-Fajt Sammlung einen würdigen Platz fand und
von Fremden ständig besucht wurde. Die graphische Sammlung und
sonstiger alter Hausrat wurde in einem riesigen Zimmer im Hoftrakt
aufgestellt.
Der
Familienüberlieferung nach soll Mayr dem mit Fluch gedroht haben,
der einmal die Stiche und Zeichnungen, welche er im größten Elend
und hungernd erstand, an einen Fremden verkaufen sollte. Marianna
Fajjt hielt an dieser Tradition fest. Sie leitete im 1. Weltkrieg die
Rot-Kreuz-Filiale Eisenstadt und war bis zum Ende des Ersten
Weltkrieges wahrhaft vermögend und war stets bereit, alle ihre
Bilder und Sammlungen auch Fremden zu zeigen.
Als
aber die Armut an ihre Tür klopfte, war sie genötigt,
Unterhandlungen betreffs Verkauf ihrer gesamten Sammlung zu pflegen.
Sandor Wolf machte ihr den Vorschlag, alles gegen eine Lebensrente
behalten zu können, nach ihrem Tode aber falle alles Wolf anheim.
Während der Verhandlungen tauchten aber Schwierigkeiten auf, aus der
Sache wurde nichts. Marianna Faajt geriet in eine noch mißlichere
Lage und veräußerte die gesamte graphische Sammlung an den aus
Ödenburg stammenden amerikanischen Sammler Hans Scholz, der 1962 in
New York die besten Stücke ausstellte.
Marianna
Faajt starb 1946 in Elend, außer den Graphiken behielt sie alles aus
dem großväterlichen Erbe unversehrt; ein Teil verblieb in
Eisenstadt bei ihrem Freundeskreis, ein anderer Teil aber wurde
zerstreut.
Wochenmarkt in den 1930er-Jahren vor dem Fajt-Haus
Repro
Stefan Millesich
In der Zwischenkriegszeit waren einige Geschäfte in dem Gebäude von
Marianne Fajt eingemietet, so der Optiker Hoffmann, der Spengler
Siertz.
Untere Hauptstraße in der Zwischenkriegszeit
rechts das Haus
von Marianne Fajt
Fotosammlung Margarete Kohs
unbekanntes Aufnahmedatum
Fotosammlung Margarete Kohs
Später gelangte das Haus in den Beitz der Familie Haenlein, die
rechts vom Tor eine Drogerie, Parfumerie und einen Fotofachhandel
betrieben und im Obergeschoß ihre Wohnung hatten. Dieser Gebäudeteil
steht leider seit Jahren leer.
Der
links vom Tor befindliche Teil war an unterschiedliche Geschäfte
vermietet, bis vor einigen Wochen an Demmer‘s Teehaus, heute noch
immer Bäckerei Gradwohl.















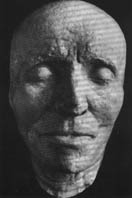

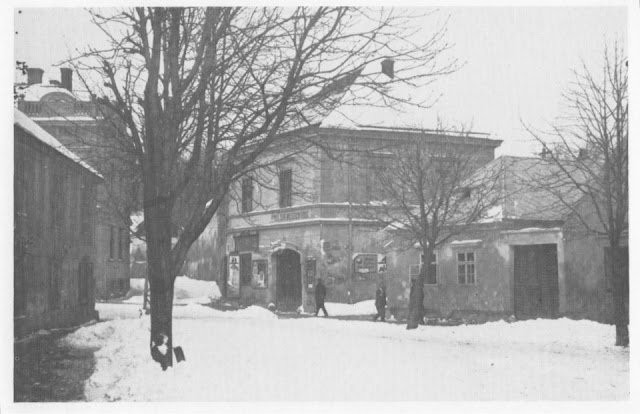
Kommentare
Kommentar veröffentlichen