Als Haydn 1761 nach Eisenstadt kam, dürfte er in einer der Wohnungen
des sogenannten „Musikgebäudes“, das sich westlich an die
Bergkirche am Oberberg anschließt und ursprünglich als Gasthaus
gedient hatte, später das „Margaretinum“ (eine
Klosterfrauensiedlung mit Schule) beherbergte, gelebt haben,
vielleicht in der Wohnung im Südosteck des ersten Stockes neben dem
Probensaal.
Margaretinum 2011
Quelle: Wikipedia
Nach dem Tod von
Haydns Vorgesetzten, dem ersten Kapellmeister
Gregor Joseph Werner, am 3. März 1766 scheint eine Umgruppierung der
Musikerwohnungen erfolgt zu sein. Jedenfalls sah sich Joseph Haydn
nach einer Wohnung in der Freistadt um. Am 2. Mai 1766 kaufte er das
Haus Nr. 82 in der Klostergasse, heute Haydngasse 21, von der
Besitzerin, der verwitweten bürgerlichen Adlerwirtin Euphrosina
Schleicherin; sie war die Witwe des Jakob Schleicher, Bürger des
äußeren Rats. Das Haus hatte in den vorhergehenden Jahren öfters
den Besitzer gewechselt. 1756 war der bürgerliche Schneidermeister
Michael Pichler Inhaber des Gebäudes; an seine Stelle tritt 1757—62
der Obrist Johann von Liptay (die Hausnummer war damals noch 78) und
seit 1762 erscheint Euphrosina
Schleicher als Besitzerin auf. Im Grundbuch 1758 (Stadtarchiv
Eisenstadt) finden wir
das Haus samt den dazugehörigen Grundstücken genau beschrieben:
„Nr. 78; 9ter Klasse 5 fl 40 Tit. Herr Obrist Johann von Liptay.
1
Hofstatt
in der Höhe
2 schöne große stockendorte
(stuckatierte) Zimmer auf die Gassen
1 große Kuchl
1
Zimmer, so nicht gewölbt mit 1 Verschlag im Hofstatt
1 Vor
Sall, so klein
Zu ebener Erd
Ein Zimmer auf die Gasse so
nicht gewölbt
Ein Zimmer in Hof nebst Kuchl
Eine gewölbte
große Cammer hinterwärths
Ein Vorkeller nebst einem größeren
daran
Eine Stallung auf 4 St.
Eine gewölbte gebüderte
(mit Bretterfußboden) Einfahrt zum Thenn
Hausgründ
3 M
(Pfund [Weingartenmaß], etwa 80-100 Klafter groß)
1 Joch (1200
Qudratklafter = 57 ar 55 qm)
½ Joch in ½ Jochen
4 Lüß
(Waldmaß) Waldungen
1 Kuchl Gärtl beym Spittal
An Vieh
1
Kuh
1 Kalben
Inwohner
Simon Großmann, ein Hauer, hat
M Alten Weingarten.“
Die Anordnung der Hausräume ist trotz der mehrfachen
Brandkatastrophen bis heute im Ganzen etwa dieselbe geblieben. Auch
gehören sämtliche angeführten Grundstücke mit Ausnahme der
Steinmühläcker jedenfalls noch bis 1927
zum Haus.
Das „Kuchlgärtl hinter den Spittal“ liegt hinter dem ehemaligen
Bürgerspital, heute Bank Burgenland, auf dem noch heute das
Haydn-Gartenhaus steht.
Der Ankauf dieses Besitzes dürfte Haydn nicht leicht gefallen sein,
bezahlte er den Kaufpreis
doch in 11 Raten bis April 1767. Euphrosina Schleicher wohnte noch
bis zu ihrem Tod im Jänner 1767 im nunmehr Haydn’schen Haus.
Haydn konnte sich dieses Hauses aber nicht lange erfreuen, denn am 2.
August 1768 brach in der Stadt ein großer Brand aus, der 2 Tage
andauerte, und der besonders die heutige Haydngasse verwüstete, so
auch Haydns Haus. Sein Gesamtschaden belief sich auf 1.148 Gulden und
27 Kreuzer, also mehr als die Hälfte des Kaufpreises, um den er das
Haus samt Grundstücken später weiterverkaufte. Obwohl der Fürst
ihm das Haus wieder aufbauen ließ, dürften zahlreiche Kompositionen
und Instrumente verbrannt sein.
Kaum hatte sich Haydn von dem schweren Schaden einigermaßen erholt,
gab es am 17. Juli 1776 neuerlich einen Großbrand, wobei der Schaden
diesmal nicht so groß war, nämlich 363 Gulden. Auch diesmal hat
Fürst Nikolaus der Prachtliebende den Bauschaden wieder gutgemacht.
Auch der Verlust an Manuskripten war geringer, weil sein Schüler
Pleyel einige der wertvollsten Werke ohne Haydns Wissen abgeschrieben
hatte.
Neben diesen Widrigkeiten hatte Haydn häufig Streitigkeiten mit
seinen beiden Nachbarinnen:
Im Haus Klostergasse
81 (heute Haydngasse 19), wohnte Magdalena Frumwaldin, bürgerliche
Weissgerberin, deren Haus heute zum Haydnmuseum dazugehört. Auf der
anderen Seite, Klostergasse 83 (heute Haydngasse 23),
wohnte Theresia Spächin, Witwe des fürstlichen Beamten Georg Späch.
Im August 1776 klagte Theresia Spächin, dass beim Aufbau nach
dem Brand eine „nachtheilige Dachung“ vorgenommen worden sei. Der
Ausgang dieses Prozesses ist wegen Verlustes der Akten unbekannt.
Fotosammlung Margarete Kohs
In
den Justizialakten des Stadtarchivs aus 1769 wird ein Streitfall
beschrieben, weil Haydn nach dem Brand von 1768 zur Stütze des neu
aufgerichteten Daches eine anstelle einer Holzwand auf Haydns Kosten
hergestellte Mauer benutzte, die Haydns Anwesen von dem der Frau
Frumwald trennte und diese zur Selbsthilfe griff und durch Entfernen
der Stütze – um halb fünf Uhr Früh – , einen Teil des
Dachsparrenwerk des Haydnhauses zum
Einsturz brachte. In einem Vergleich wurde die
Trennmauer für gemeinschaftlich anerkannt und beiden Parteien
untersagt, auf den von ihnen errichteten Teilen "aufzubauen".
1773 begehrte Haydn beim Rat der Stadt einen Revers, da Frau
Frumwaldin entgegen dem seinerzeitigen Vergleich auf "ihrem"
Teil der Mauer aufgebaut habe.
Am 27. Oktober 1778 verkaufte Haydn das gesamte Anwesen um 2.000 fl (Gulden) an den fürstlichen Buchhalter Anton Liechtscheidl. Haydn dürfte in der Folgezeit wieder in einem fürstlichem Gebäude, wahrscheinlich nunmehr in der Musikerwohnung des Musikgebäudes, gewohnt haben.
Das Haydnhaus erlebte in der Folgezeit noch mehrfachen
Besitzerwechsel:
1781 war im Grundbuch noch Theresie Liechtscheidlin auf, 1784 der
fürstliche Rentmeister Franziskus Häuler, 1794 der fürstliche
Raitoffizier Anton Boje, ab 1803 der Handwerker und Magistrat
Matthias Strodl, ab 30.6.1842 der Bräumeister Johann Jakob aus
Sommerein, nach seinem Tod 1876 seine Enkelinnen Frida und Karoline
Kornmüller.
Zwei Gedenktafel schmücken das Haydn-Haus: eines
mit ungarischem Text aus 1898, das ander mit deutscher Inschrift aus
1923.
Haydnhaus um 1912
Foto: PÉCHY LÁSZLÓ
Haydnhaus um 1912
Foto: PÉCHY LÁSZLÓ
1925 wurde der Heimatschutzverein gegründet, der auch eine Sammlung
an Erinnerungsstücken ankaufte.
Als 1926 das Landesmuseum gegründet wurde, stellte der
Heimatschutzverein seine Objekte zur Verfügung. Nach dem Ende der
Ausstellung mietete der Verein Räume des Haydnhauses an, um die
Sammelstücke unterzubringen. 1935 konnte der Verein von Frau
Kornmüller drei Räume mieten, u. zw. jene Räume, die Haydn
persönlich für den Alltag benützt haben soll. Im ersten Inventar
scheinen die Textbücher zu den „Sieben Worten“ und zu der
„Schöpfung“ auf, sie waren der Grundstock der Museumssammlung.
Haydnhaus 1931
Quelle: ÖNB Bildarchiv und Grafiksammlung (POR)
Der Verein konnte Gönner finden, so die Bgld. Landeshauptmannschaft,
die Stadt, die Geldinstitute und Versicherungsgesellschaften, Herr
Wolf half mit Vitrinen aus, das Elektrizitätswerk ließ alle nötigen
Installationen kostenlos durchführen und spendete auch die
Leuchtkörper.
Am 23.6.1935 fand die feierliche Eröffnung des Museums statt, es
wurde auch weiter von Frau Hydn betreut, welche auch mit ihrer Mutter
den Vordertrakt des Hauses bewohnte.
Damals entstand auch der Plan, das ganze Haus käuflich zu erwerben,
was natürlich auch Geldsorgen auslöste. Es wurden daher Aufrufe in
Tageszeitungen erlassen, und der Bildhauer Ambrosi hob bei den
Besuchern seines Ateliers in Wien Spenden ein. Außerdem spendete er
eine stattliche Summe, die er anlässlich der Enthüllung des
Lisztdenkmals 1936 bekam.
Univ. Prof. Dr. Eduard stiftete so viele Erinnerungsstücke von
Liszt, dass mit ihnen ein ganzes Zimmer ausgefüllt werden konnte.
Erinnerungsstücke an Fanny Elßler kamen in reichem Maße durch ihre
Verwandtschaft, so von Frau Püschely, Frl.
Fajt und von Altbürgermeister Ecker in Rust.
Fotosammlung Margarete Kohs
Am 15.12 1937 schloss der Vereinsobmann einen Kaufvertrag um 24.000
Schilling mit Frau Kornmüller für das Haus in der heutigen
Haydngasse und das Haydnhäuschen ab, wobei Ratenzahlung vereinbart
wurde. 1938 übernahm die Landeshauptmannschaft und dann der Gau
Niederdonau die ausständigen Raten, sodass das Haus in Landesbesitz
überging. Die Gauhauptmannschaft bestimmte, dass Erinnerungsstücke
an Haydn, Liszt und Fanny Elßler vom Privatmuseum Wolf ins
Haydnmuseum integriert wurden.
Treppe im Haydnhaus im Laufe der Zeit:
Während des Krieges und der Besatzungszeit hatte das Museum keinen
Schaden erlitten. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist das Haus zusammen
mit verschiedenen Sammlungen in das Eigentum des Landes Burgenland
übergegangen, das Gebäude wurde in den 1970er Jahren zu einer Haydn
gewidmeten musealen Gedenkstätte umgestaltet.
Fotosammlung Margarete Kohs
Während der Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten zum Haydn-Jahr
2009 wurden die originalen Wandgestaltungen der Haydn-Zeit in zwei
Zimmern freigelegt. Heute sind die Räume mit originalen Möbeln aus
der „Haydnzeit“ eingerichtet, die Grundlage für die
Dauerausstellung „Zimmer, Kuchl und Cammer“ darstellen. Außerdem
werden Originalportraits von Haydn,
persönliche Briefe, Noten und musikalische Widmungen gezeigt, sowie
ein Anton Walter-Hammerflügel von 1780, ein Porträtmedaillon von
Haydns Gattin Maria Anna Theresia und vieles mehr.
Fotos: © Heiling / Lorenz
Frau
Margarete Kohs, die so viele Fotos gesammelt, affichiert, kommentiert
und geordnet hat, am 13.5.2010 im Hof des Haydnhauses
Und von Zeit zu Zeit, wenn es die Pandemie wieder erlaubt, gibt es Führungen in historischen Kostümen
„Bei
den Haydns - ein
schrecklich nettes Ehepaar“.
Fotos: Hans Larnhof, 10.5.2019
Quellen:
Dr. Ernst Fritz Schmid, Joseph Haydn in Eisenstadt,
Burgenlaendische-Heimatblaetter_1_0002-0013-2.pdf
Oskar Gruszecki, Die Entstehung des haydnmuseums in Eisenstadt,
Burgenlaendische-Heimatblaetter_21_0087-0090.pdf
Berichte des Bgld. Heimat- und Naturschutzvereins, Feierliche
Eröffnung des Haydnmuseums in Eisenstadt,
Burgenlaendische-Heimatblaetter_4_0162-0164.pdf



























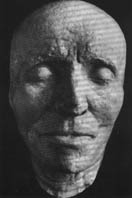

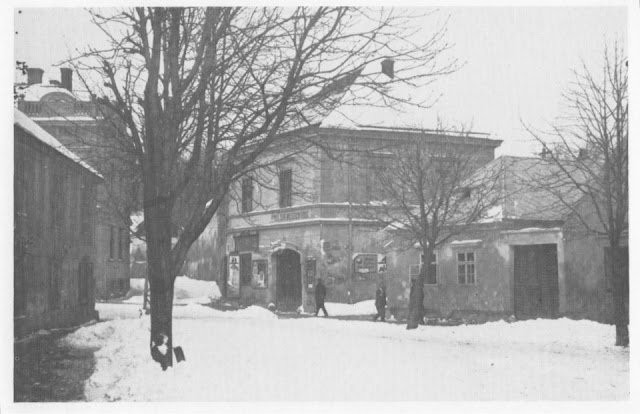
Kommentare
Kommentar veröffentlichen